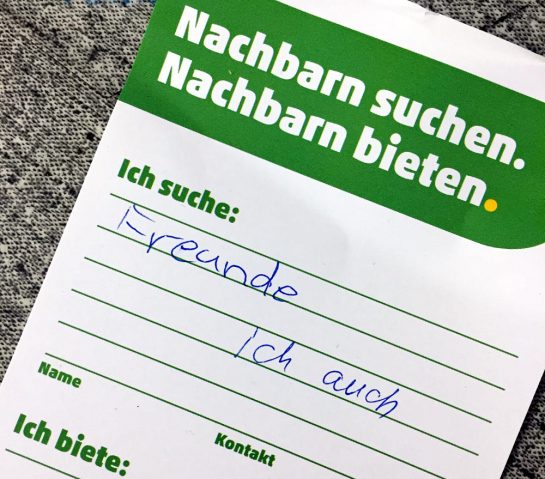Zweiter Tag des Digital Media Camps in München, #dmcmuc.
Das Aufstehen fiel ein bisschen schwer. Ich konnte gestern schlecht einfschlafen: viele Leute, viele Gespräche, viel Input. Außerdem war es mir kalt.
Bei der Sessionplanung war die Schlange nicht sehr lang. Also stellte ich mich nochmal an und bot eine Session zum Thema „Bloggen“ an, in der ich erzählte, wie ich warum blogge, was mir das bringt, wie ich das Kännchennblog und das berufliche Blog, den Newsletter und den Podcast vernetze, wie es mit der Privatheit ist, was meine Haltung ist und so allerlei nebenher.
https://twitter.com/AustriaArt/status/965177506574864384
Irgendwie schaffe ich es nicht, zu einem Barcamp zu fahren und keine Session zu halten.
Die nachfolgende Session mit Ingo von der DB Systel habe ich dann leider verpasst, weil ich mich verquatscht habe. Es wäre die Ergänzungssession zu Matthias Patz auf dem AgiLEipzig gewesen.
Nach dem Mittag gab’s dann noch eine Dreiviertelstunde zu Podcasts von Katja und Sabine. Es ging um Nutzen, Einsatz und Monetarisierung. Tolle Sache: Sabine hat mich heute eingeladen, in einer Folge des Talk-Big-Podcasts teilnzunehmen. Ich freue mich! Am Mittwoch bin ich dann bei ihr in Sendling, und wir nehmen die Folge auf.
Zur Session kam ich übrigens zu spät, weil ich mich wieder verquatscht habe – diesmal mit Basti & Lorenz, den Caterern. Die beiden haben ein super Essen ins Foyer der Süddeutschen gezaubert, alles ohne Müll, denn sie machen Zero-Waste-Catering. Der Eine ist eigentlich Banker, der Anderer BWLer; die Beiden sind Anfang 20 und machen alles selbst: Rezepte, Zubereitung, Logistik – mit Unterstützung von Küchenhilfen. Weil ihnen ein Angebot an gutem, müllfreien, gesunden Caterin in München fehlte, haben sie sich im Februar 2017 mit der Idee selbstständig gemacht. Starke Typen und ein rundes Konzept von Speisen, Darreichung, Corporate Design und Leidenschaft. Ich wünsche den beiden viel Erfolg!
Zurück nach Hause wollte ich dann ein Stück zu Fuß gehen. Also marschierte ich los, die Straße hinunter durch Berg am Laim. Das Michaelibad war nicht weit, und dort würde die U5 fahren.
Als ich am Michaelibad ankam, war dort auch der Ostpark, und ich dachte: Dort ist es bestimmt auch schön. Also ging ich durch den Ostpark.

Im Ostpark gibt es einen Hügel. Wenn ich Hügel sehe, möchte ich dort hinauf, um hinunterzuschauen. Das ist so eine Marotte von mir.
So sah das dann aus:

Im Park gab es viele Gelegenheiten zu rodeln, und der Münchener hat offenbar seinen Schlitten stets parat.
Im Ruhrgebiet wäre man an einem Tag wie heute in den Keller gestiegen, hätte den Schlitten hinter dem Kartoffelschoss hervorgezerrt, ihn entstaubt und festgestellt, dass die Kufen rostig sind. Dann hätte man Schmirgelpapier gesucht, nicht gefunden, und wäre in den Baumarkt gefahren, um welches zu kaufen. Dort hätte man festgestellt, dass ja Sonntag ist, also hätte man Onkel Hans angerufen und gefragt, ob er eventuell Schmirgelpapier hat. Wieder zu Hause hätte man die Kufen geschmirgelt und gewachst. Dann hätte man den Schlitten feierlich aus dem Keller getragen, und wie man vor der Haustür stünde, mit Schlitten, Schneeanzug und Schlupfmütze, wäre der Schnee geschmolzen.
Aber der Münchener ist auf Schnee vorbereitet, der Schnee ist auch deutlich ausdauernder, und so rodelten die Leute allerorten.

Hinter dem Ostpark kam rasch die Quiddestraße. Dort fährt auch die U5. Von der Quiddestraße sind es jedoch nur noch drei Stationen bis nach Neuperlach-Süd. Es wäre nun wirklich albern gewesen, dafür noch die U-Bahn zu benutzen. Also marschierte ich weiter. Mich erfasst dann immer eine sanfte Forrestgumpigkeit, ich laufe und schaue in die Gegend und laufe weiter, denn stehenbleiben ergibt ja keinen Sinn, und so laufe ich und laufe.
So kam ich zum Park & Ride in Neuperlach und zu meinem Auto, mit dem ich heim in mein Appartment fuhr.

Bis morgen!