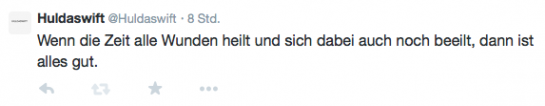Nachwuchs
Sie betreuen die beiden Jungs nun schon fast ein Jahr, den kleinen etwas länger. Die beiden Kinder, einer 7, einer 14, sind über die Balkanroute gekommen, mit einem Cousin, der auch noch keine 18 ist. Niemand weiß so genau, wie. Jetzt sind sind jedenfalls da.
Die zwei Erwachsenen – Freunde von mir – haben die Vormundschaft für sie übernommen. Einer muss es ja tun, sagen sie sich – sich kümmern um diese Kinder, deren Eltern noch in der Türkei sind und dort festsitzen, vielleicht aber auch gar nicht kommen wollen. Auch das weiß niemand so genau. Jetzt sind sie jedenfalls nicht hier.
Sie taten sich erst schwer, die Jungs wie auch die Erwachsenen, die jetzt die Verantwortung für sie tragen, die Formulare für sie unterschreiben und sie am Wochenende aus der Heimgruppe abholen; die dafür sorgen, dass sie in die Schule gehen, in eine richtige Klasse auf einer guten Schule, eine mit Integrationkonzept und Menschen, die willens sind, das Beste aus dem zu machen, was aktuell geht.
Der Kleine – er spielt und lacht und spricht, auch unsere Sprache schon: Es reicht für den Bolzplatz, fürs Schwimmbad und meistenteils sogar in der Schule – ganz schnell ging das. Der Große hat es nicht so leicht. Deshalb fragen die Erwachsenen ihn: „Was gefällt dir? Wofür interessierst du dich?“, und er antwortet: „Tauben.“
In Syrien, sagt er, und der kleine Bruder übersetzt, habe er Tauben gehabt. Er habe sie fliegen lassen, und sie seien wieder zurück gekommen. Es seien besondere Tauben gewesen, teure Tauben – solche, wie sie nur wenige in Damaskus haben.
„Dann bist du ja hier im Ruhrgebiet ganz richtig“, sagen sie, und durchforsten das Internet nach Taubenzüchtern in der Nähe. Beim ersten, den sie anrufen, nimmt ein Frau ab. Es tue ihr leid, sagt sie, ihr Mann sei bereits seit Jahren tot. Sie rufen den nächsten an, der sagt: Drei Schlaganfälle habe er gehabt, und deshalb nun keine Tauben mehr. Sie rufen beim dritten an, tragen ihr Anliegen vor und hören sofort: Er freut sich. „Wissen Sie“, sagt er, „wir haben ein Problem mit der Jugend. Oder die Jugend mit uns.“ Doch welch glücklicher Zufall: „Am Wochenende, da haben wir Jahrestagung, da können Sie direkt vorbeischauen.“
Die beiden, die jetzt die Verantwortung tragen, nehmen die Jungs und fahren hin. Sie finden die Wiese, auf der Bierbänke stehen, in Reih und Glied, auf denen alte Männer sitzen, sehr alte Männer. Schon die beiden Erwachsenen wären aufgefallen, aber als sie mit den Kindern auftauchen, diesen beiden Jungs mit ihren schwarzen Haaren und ihrem dunklen Teint, verstummen sofort alle Gespräche. Biergläser werden abgesenkt und leise auf die Tischen gesetzt. Insekten summen im Gras. Jemand hustet in seine Hand.
Dann steht einer auf. „Schön, dass ihr da seid“, sagt er. Es ist der, mit dem sie telefoniert haben.
Sie fragen: „Wo sind denn die Tauben?“
Die Tauben, erklärt er, seien schon in ihren Schlägen. In Nürnberg seien sie heute morgen losgeflogen, nun vergleichen die Besitzer nur noch die Listen. „Aber“, sagt er, und beugt sich hinab zu den Jungs, „wir haben Grillwürste. Wollt ihr welche?“
Die Jungs setzen sich auf eine Bank trinken Cola, denn die Würste sind aus Schweinefleisch, und es ist alles etwas komisch. Die Alten schauen sie die ganze Zeit an; sie unterhalten sich zwar wieder, aber dennoch: Ihre Köpfe recken sich unentwegt nach den Jungs.
Die Erwachsenen mühen sich indes im Small Talk. Eigentlich können sie das gut, nur heute nicht, nicht mit diesen Alten, deren Hobby ihnen so fern ist. Das Gespräch verebbt schnell. Schade, denken sie. Aber einen Versuch war’s wert.
Dann steht zwei Bänke weiter noch einer auf. „Mein Schlag ist ganz in der Nähe“, sagt er zu den Jungs. „Wenn ihr wollt, können wir hingehen und die Tauben anschauen.“ Der Kleine übersetzt, und der Große beginnt zu lächeln.
Als sie zwischen den Tauben stehen, die flattern und Staub und Federn aufwirbeln, ist das Lächeln immer noch da. Der große Junge erzählt dem alten Mann von seinen Tauben, der kleine übersetzt. Viele Worte fehlen, doch es ist nicht schlimm: Sie deuten auf Federn, machen Gesten und nicken. Erst, als der alte Mann einmal gar nicht verstehen will, holt der Junge sein Handy heraus, tippt und hält es dem Alten hin, zeigt auf das Bild mit den Vögeln, wischt weiter, noch ein Bild, und wischt weiter. Er hat auch Videos, tippt sie an, und die Tauben fliegen wieder durch Damaskus. Der alte Mann nickt anerkennend. „Schöne Tiere“, sagt er – und fragt dann: „Wie habt ihr sie gezähmt?“
Der Große erzählt und formt die rechte Hand, als sitze darin eines der Tiere. Dann nimmt er die linke und bewegt sie um die rechte. „Tesafilm“, übersetzt der Kleine. „Flügel mit Tesafilm. Eine Woche. Dann wissen Tauben, wo sie wohnen.“
Das Alte wird blass und hebt die Brauen. Dann sagt er: „Das machen wir hier anders.“ Er sagt es nicht böse. Aber mit Nachdruck.
Als sie sich zum Abschied alle die Hände schütteln, vereinbart er einen Termin mit den Erwachsenen. Nächste Woche könne er nicht, sagt er, aber danach solle der Junge ruhig wieder vorbeischauen. Nachwuchs, sagt er, sei immer willkommen.