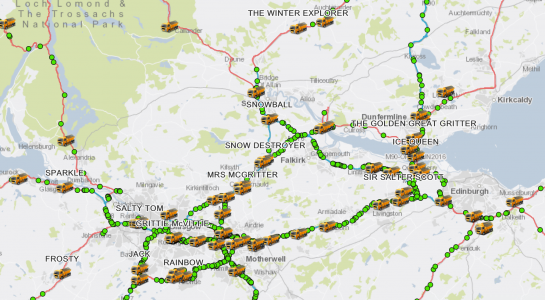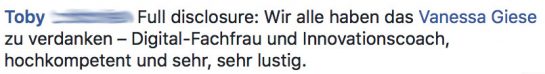An einer kleinen Umfrage zum Thema „Berufswahl und Berufszufriedenheit von Frauen“ teilgenommen. Im Fragebogendesign ist noch Luft nach oben – doch was ich eigentlich sagen möchte und was mir dazu eingefallen ist:
Der Fragebogen fragt, wer mich in der Wahl meines Berufs beeinflusst hat. Das ist schwierig zu beantworten, weil der aktuelle Beruf, den ich ausübe, nicht meinem Ausbildungsberuf entspricht, weil ich überdies mehrere Ausbildungen habe und auch schon in mehreren Berufsbildern gearbeitet habe. Fast immer kam der Antrieb aus mir selbst heraus.
Denn weder Eltern noch Schule noch Mitschüler haben mich explizit für etwas beeinflusst im Sinne von wirklich antreiben, anspornen, beflügeln. Unterstützt schon, also meine Entscheidung mitgetragen, aber nicht beeinflusst.
Ich erinnere, dass es seinerzeit (1990er) allerdings eine unterschwellige Beeinflussung in Schule und meinem Umfeld gegen etwas gab. Zum Beispiel fühlte ich mich seltsam und nicht richtig, wenn mir als Mädchen naturwissenschaftliche Fächer Spaß machten. Es war okay, sich für Technik zu interessieren, aber eher in einem naiven Sinne, nicht mit einem ernsthaften, beruflichen Antrieb. Ich erinnere mich, dass ich Chemie-LK wählen wollte und statt eines ermutigenden „Oh, wie toll“ oder zumindest einem gleichgültigen „Ah, okay“ Reaktionen bekam wie „Meinst du, das kannst du?“, „Das ist doch was für Jungs“ oder „Dann bist du nur mit Jungen im Kurs, das würde ich mir gut überlegen“. Meine Wahrnehmung mag natürlich auch an der Pubertät und meiner eigenen Suche nach Weiblichkeit gelegen haben; nichtsdestotrotz erinnere ich keine Ermutigung, sich für Berufe oder Themenfelder zu interessieren, die als unweiblich galten, sondern ein Beeinflussen in die andere Richtung.
Außerdem wurde in meinem Umfeld – nicht meine Eltern, sie haben mich unterstützt – eher klein gedacht; ich bin bislang immer noch die einzige in der Familie, die studiert hat. Ich erinnere mich an ein Gespräch auf einer Familienfeier, ich muss 15 oder 16 gewesen sein, jedenfalls in einem Alter, in dem es um die Berufswahl geht. Die Anwesenden gingen die Optionen für mich durch, darunter Kindergärtnerin (weil man das gut mit den eigenen Kindern vereinbaren kann) und Bürokauffrau (weil die ja immer gebraucht werden); Berufe, die ein Studium erforderten oder die einen ambitionierteren Karriereweg als Sachbearbeiterin oder Vorzimmerdame vorsahen, waren nicht auf dem Radar. Als der Vorschlag „Zahnarzthelferin“ kam, antwortete ich: „Wenn schon, dann werde ich Zahnärztin“, woraufhin die Runde schallend – ja, tatsächlich: laut und aus voller Kehle – lachte und mit Äußerungen wie „Ach, wie süß“ und „Hat man sowas schonmal gehört?“ abtat; für sie war der Gedanke tatsächlich völlig abwegig, lächerlich und naiv. Ich war in dem Moment sehr beschämt, es war mir unendlich peinlich; wer ist schon gerne Gespött der Anderen? Im Nachhinein wurde ich dann aber so wütend, dass ich beschloss, auf jeden Fall studieren zu gehen. Heute bin ich in der Grafik die 1 unten rechts: Das eine von 100 Arbeiterkindern, das seine Promotion abgeschlossen hat – im Gegensatz zu 10 aus Akademikerhaushalten. Wenn ich auf diesen Titel stolz bin, dann nie um des Titels willen (für den ist Leidensfähigkeit zehnmal wichtiger als Intelligenz, wenn Sie mich fragen), sondern einzig wegen dieses Weges.
Im Rückblick ist es gut, dass ich diese Erfahrungen machen durfte; sie haben mir viel gegeben: Willen, Durchhaltevermögen, Selbstorganisation, Zeitmanagement, Prioritätensetzung, Klarheit, Konsequenz und das Wissen darüber, welche Dinge ich gut und welche ich nicht so gut kann. Zwischendurch war es anstrengend, sich zu behaupten, mental und finanziell, vor allem mental. Das Geld war das geringere Problem, das kam irgendwie, dafür konnte ich arbeiten, in mehreren Jobs: in der Woche Nachhilfe geben und als Tutorin an der Uni, am Wochenende bei der Tageszeitung und in den Semesterferien im Messebau oder in der Fabrik. Aber sich zurechtzufinden in einer Welt, die nicht die eigene ist, und zwischen den Welten navigieren – mit ihren unterschiedlichen Erwartungen, Sprachen und Kulturen: Das war ermüdend und ist es manchmal heute noch.
Deshalb halte ich Unterstützung, Horizont erweitern und Mutmachen für viel, viel wichtiger als die Geldfrage, um Arbeiterkinder an die Uni zu bringen. Der Wunsch, mehr zu wollen, der Mut, es zu tun, und dabei das Gefühl, eine Hand auf dem Rücken zu haben, die mal schiebt, mal streichelt und mal knufft, das ist es, was Kinder von Nichtakademikern brauchen. Wenn sie das haben, regeln sie die Geldsache selbst.
Ich bin ein Mensch geworden, der nicht die Hemnisse sieht, sondern die Möglichkeiten. Ich bin ein Mensch, der Welten verbindet und vermittelt. Ich bin eine gute Mutmacherin.
*
Huch – zu früh auf „Veröffentlichen“ gedrückt. Das passiert, wenn man nachts um kurz vor 1 Uhr schonmal die ersten Gedanken für den Freitagspost niederschreibt. Ich aktualisiere einfach:
Update, 22:00 Uhr
Aus der Abteilung „Einfach mal machen“: Podcast. Den ganzen Tag am Podcast rumgedengelt. Denn yeah! Ich podcaste jetzt! Gemeinsam mit dem geschätzten Christian de Vries, den ich auf dem Barcamp in Dangast kennengelernt habe.
In der Podcast-Session auf dem Barcamp Dangast hieß es: „Das ist alles nur ein Klick!“
Hahahaha!
//*leicht hysterisches Lachen
Wenn man eingerichtete Accounts beim Hoster hat – und bei Soundcloud und bei iTunes und wenn man ein Intro und ein Outro hat und einen RSS-Feed und ein Logo und einen Header und beides nochmal in anderen Auflösungen und eine fertige Sounddatei und funktionierende WordPress-Plugins und überhaupt: Wenn man den ganzen Dreh raus hat, ist das sicherlich nur ein Klick. Heute waren das circa … nun … 800 Klicks. Oder 1.000. Gefühlt 100.000. Jedenfalls acht oder zehn Stunden am Schreibtisch. Ich freue mich auf später, wenn der Podcast groß ist und es wirklich nur noch ein Klick ist.
Ergebnis des Tages: Tada! Das Baby ist online, hier im Blog, bei Soundcloud, bei Podigee und bei iTunes. Es hat ein Intro und ein Outro und sowas wie ein Logo (nun ja, zumindest erstmal eine Grafik, in der der Titel steht). Ich schreibe nochmal einen eigenen Beitrag zum Podcast und der Idee dahinter.
Hier ist das Ding: Ein Mann. Eine Frau. Ein Gespräch. Die Frau bin ich, der Mann ist Christian. Der Titel der ersten Folge: Kennenlernen.
https://soundcloud.com/einmann-einefrau-eingespraech/ein-mann-eine-frau-ein-gesprach-januar-2018-kennenlernen
Christian hat unsere Premiere sehr schön anmoderiert, besser kann ich’s nicht machen:
Wir reden über uns, über das Kennenlernen, über Schwierigkeiten, über Mut, über Erwartungen, über das Zuhören, über Ameisenschutzwarte, über @50hz, wir finden uns gegenseitig toll, wir reden über Twitter und Barcamps. Gelernt: Vanessa möchte tatsächlich gern mal mit Angela Merkel auf dem Sofa sitzen. Was ich wiederum sehr gut verstehen kann. Und sie möchte sich mit Volksmusik-Sängerinnen und Sängern unterhalten. Ähem, tja. Dann reden wir über Mut.
*
Am späten Nachmittag meldete sich ein anderer Christian, der Jawl: Er und S. seien bei mir um die Ecke am See, ob ich Lust auf einen Kaffee hätte. Aus dem Kaffee wurde Sushi, und es war eine sehr gute Idee – das Sushi und das Treffen. Mit Sonnenuntergang auf dem Hinweg.