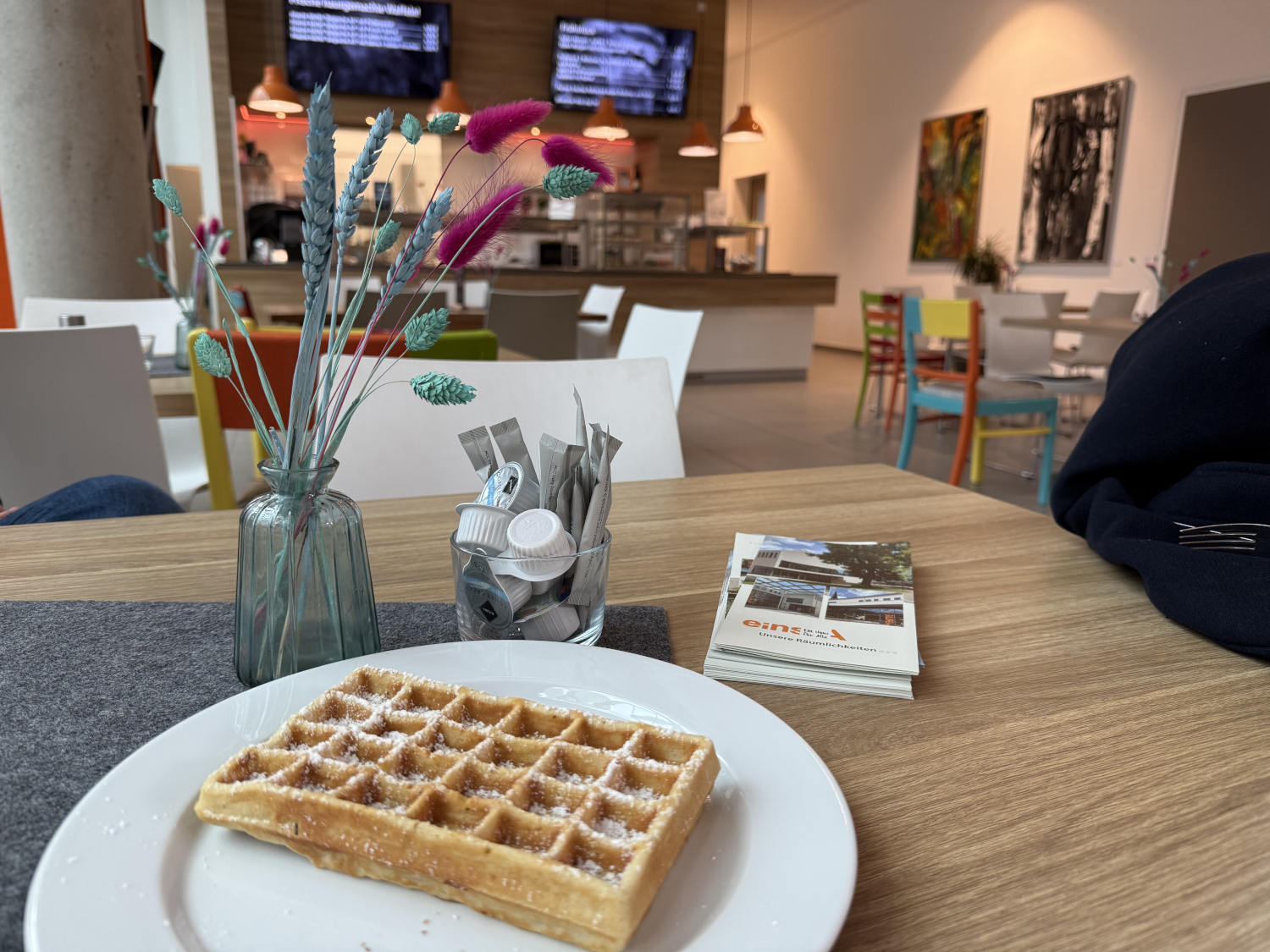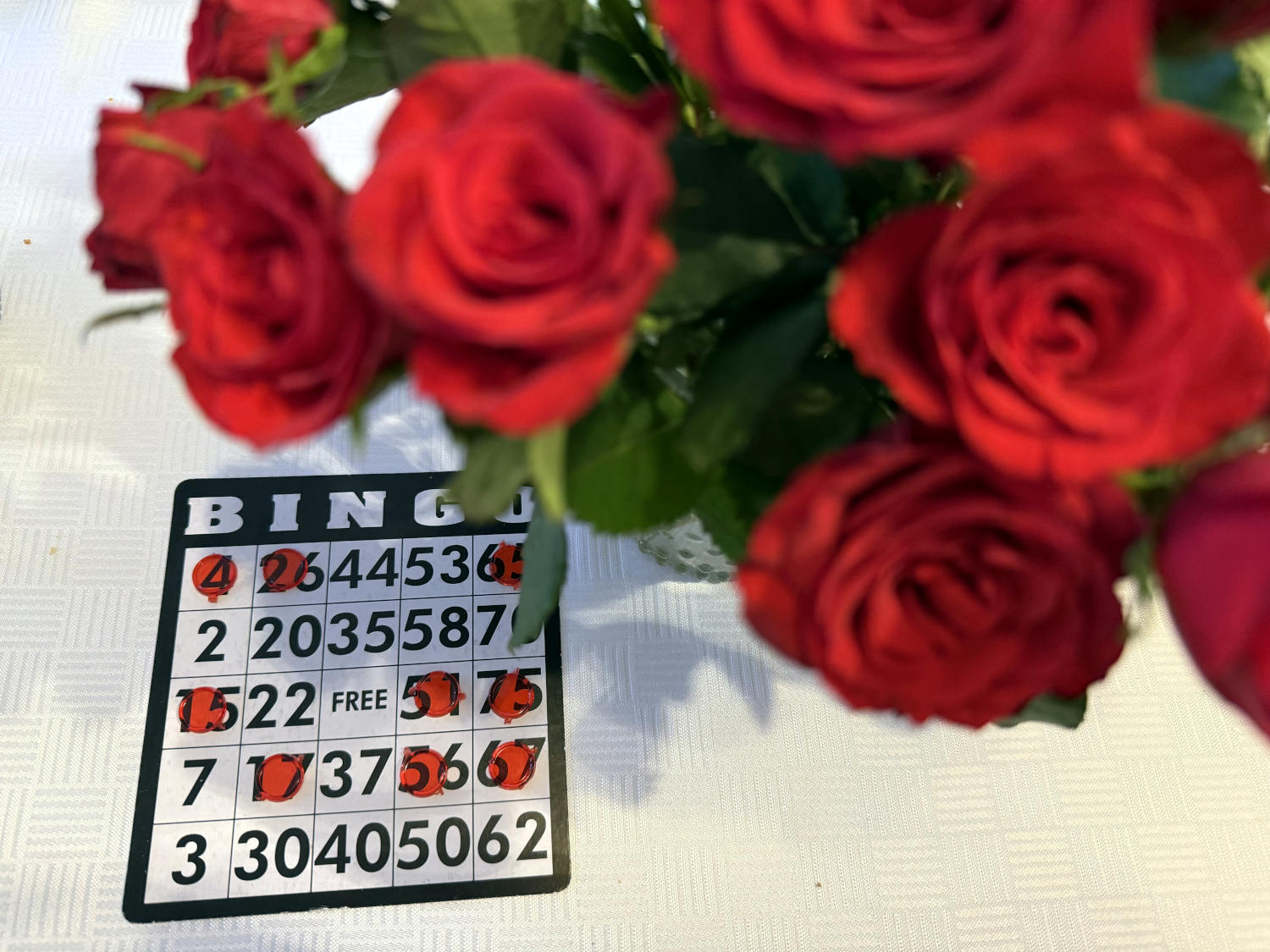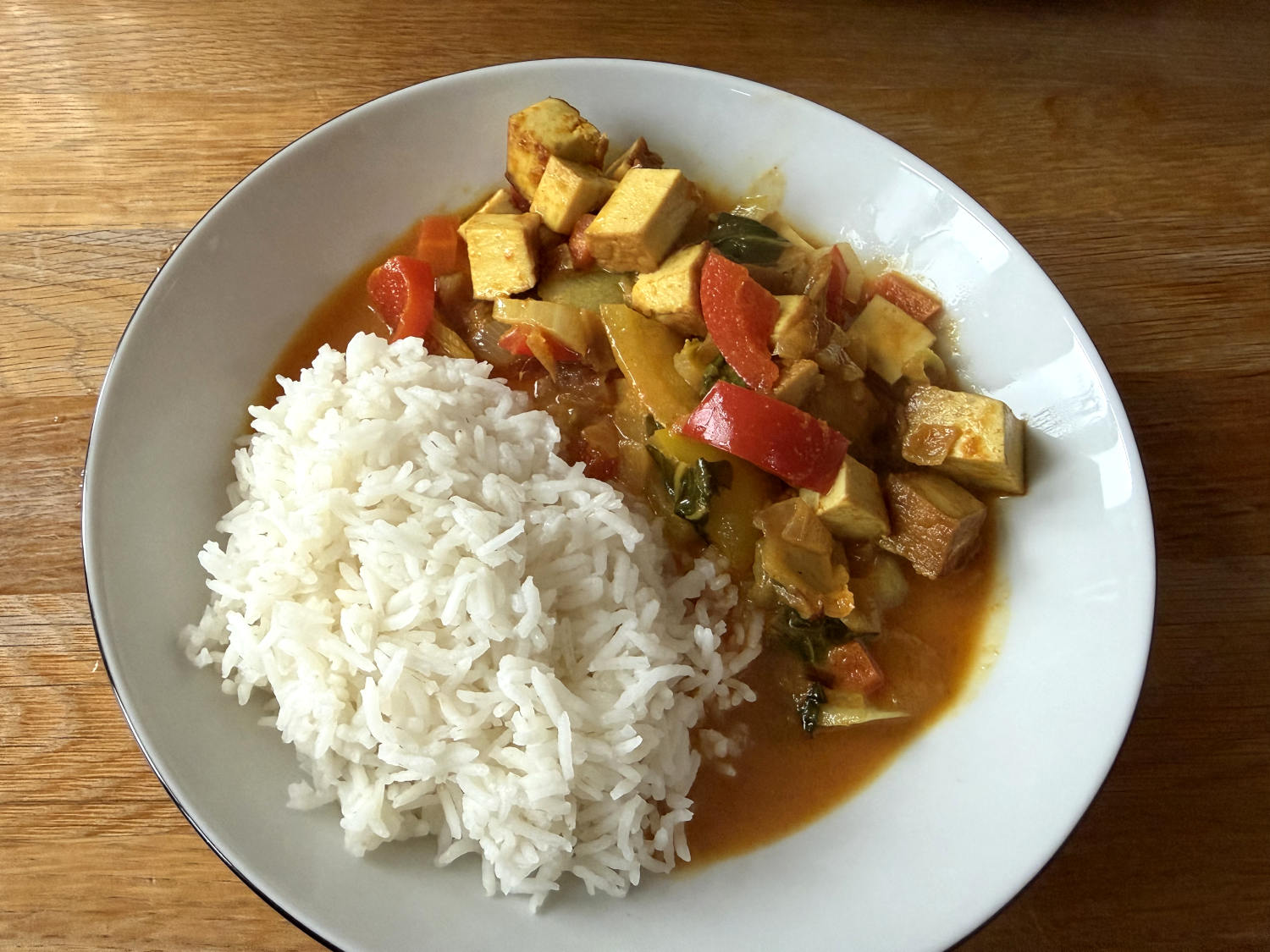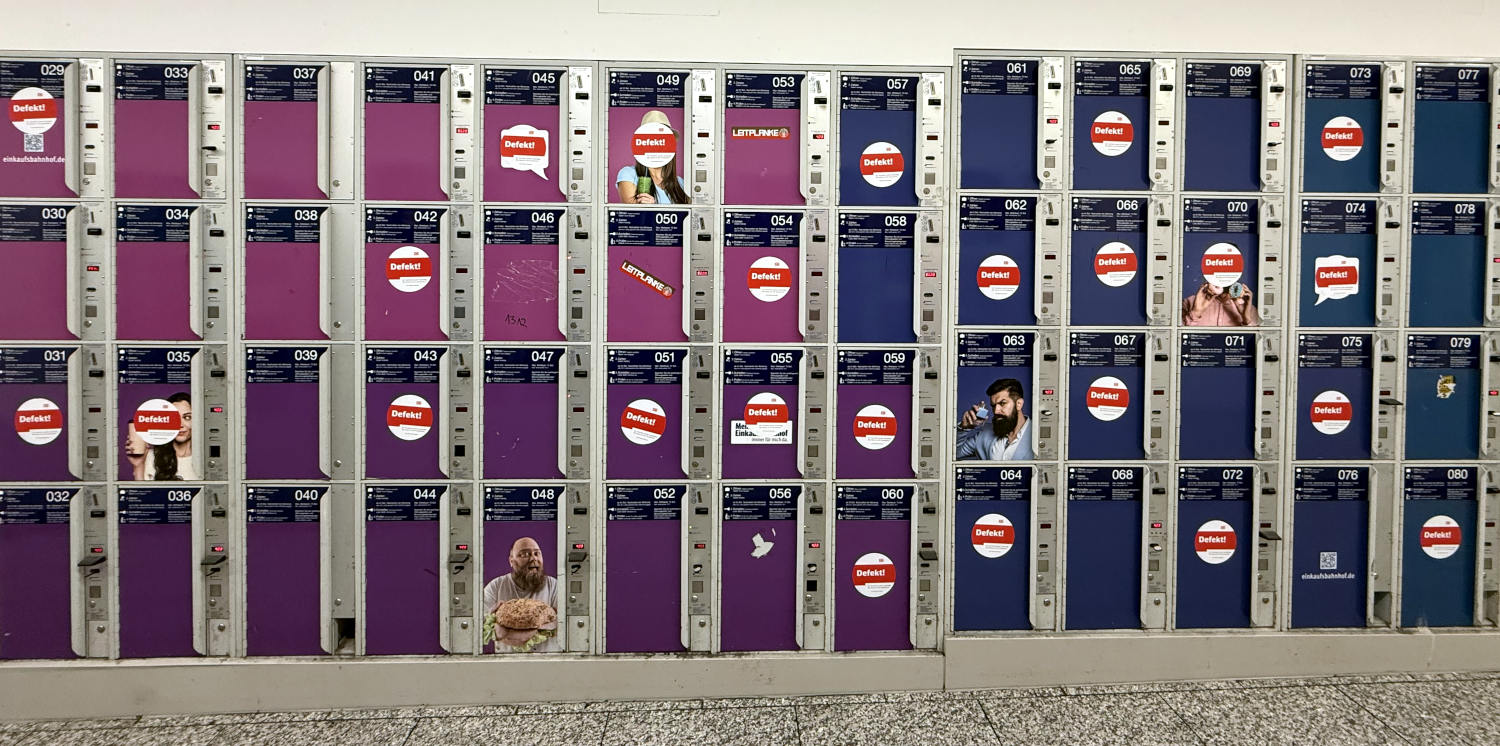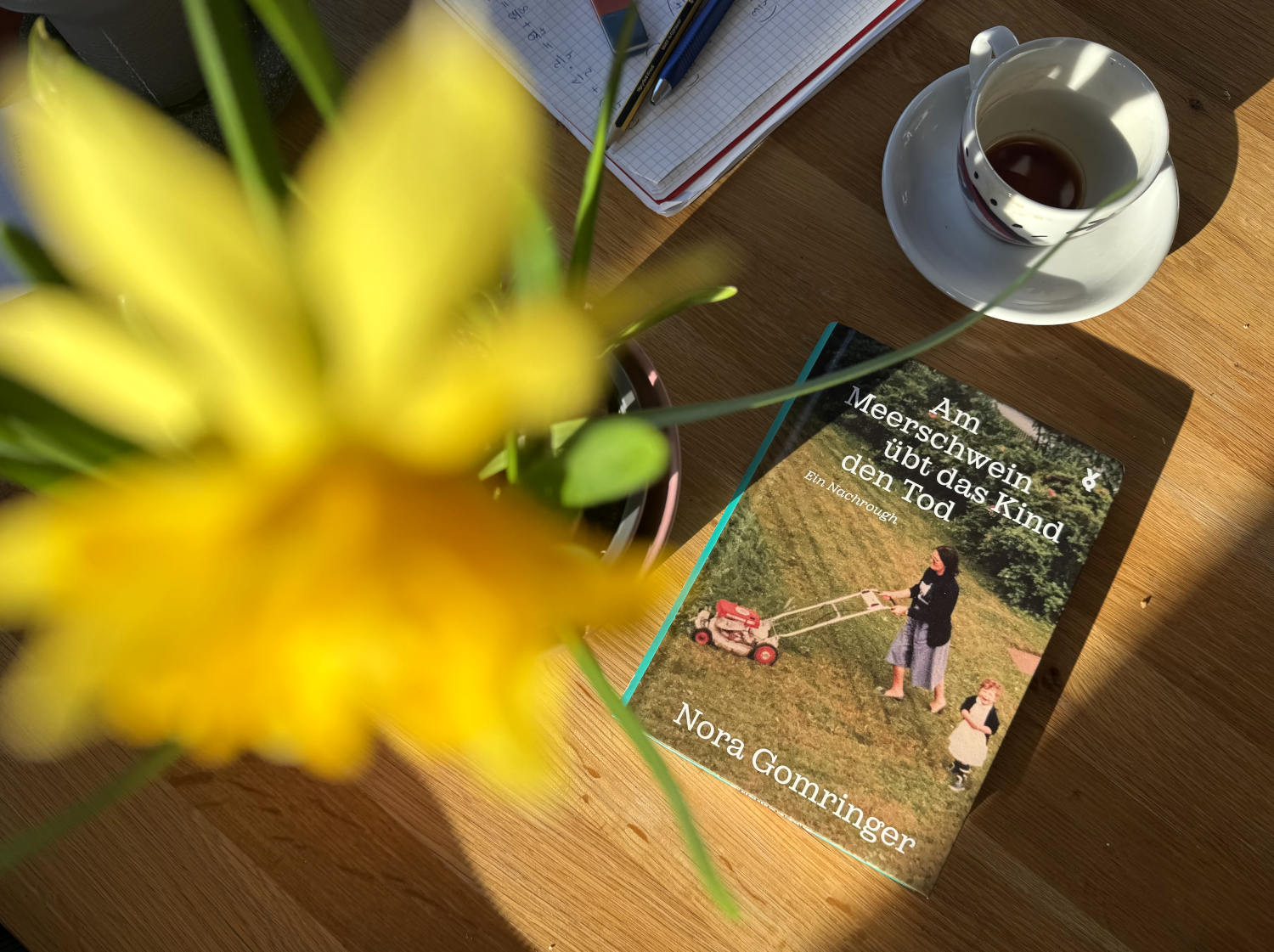Broterwerb | Danke für Eure Rückmeldungen! Am Montag habe ich gefragt, ob Ihr Interesse an einem Seminar habt – und wenn ja, an welchem. 31 Personen haben an meiner Umfrage teilgenommen, 27 davon interessieren sich für „Professionell bleiben, auch wenn es ruckelt“. Ich bin jetzt mit dem EinsA ins Gespräch. Nächster Schritt: Die Veranstaltung kalkulieren und ihr einen Termin geben. Stay tuned!
Aktuell bereite ich ein zweitägiges Training für Ausbildungskoordinatoren vor. Sie betreuen Auszubildende und duale Studierende bei einem Landmaschinenhersteller. Die Ausbilder – kein Gendern notwendig im konkreten Fall – möchten die Azubis besser unterstützen, sowohl in guten wie auch in schwierigen Zeiten.
Am ersten Tag reflektieren wir die „Lebensphase Azubi“, tauchen in eigene Erinnerungen ein, und ich gebe Hintergrundinfos aus der Entwicklungspsychologie. Es ist nämlich mitnichten so, dass wir mit achtzehn oder zwanzig Jahren fertige Erwachsene sind – in dem Alter ist noch eine ganze Menge los in der Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung. Am Nachmittag trainieren die Ausbilder ihre Coachingkompetenzen. Wir machen konkrete Übungen, wie sie die Azubis stärken können, indem sie ihnen Fragen stellen, gemeinsam mit ihnen die Probleme hinter dem Problem anschauen und Lösungen entwickeln.
Für den zweiten Tag habe ich angeregt, nicht nur über, sondern auch mit den Azubis zu reden. Vormittags gibt’s deshalb ein Forum – ich moderiere das und bin gespannt, welche Perspektiven die Auszubildenden mitbringen. Am Nachmittag sprechen wir dann noch über konflikthafte Situationen: Wie agiere ich, wenn es beim Azubi in der Schule nicht klappt, wenn er ausweicht, blockiert oder es andere Probleme gibt.
Die Veranstaltung macht mir große Freude, weil sie junge Menschen stärkt – und die Menschen, die junge Menschen stärken. Ich schrieb ja jüngst über meinen Blick auf die jüngere Generation.
Leser’innenfrage | Auf der Themen-Vorschlagsliste sind interessante neue Fragen, zum Beispiel, was ich beruflich noch erreichen möchte oder was ich beim Alleinreisen gelernt habe. Danke dafür! Darüber denke ich sehr gerne nach – ein guter Impuls, auch für mich. Heute widme ich mich einer älteren Frage: „Wer oder was hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?(wenn nicht zu privat)“
Mit 16 allein nach Moskau. Anfang der 1990er Jahren hatte meine Schule eine Partnerschule in Moskau. Die Moskauer waren bei uns, wir waren in Moskau. Dann fragte meine Gastfamilie, ob ich sie in den Sommerferien besuchen wolle, allein. Sie schickten eine Einladung, mein Vater und ich fuhren nach Bad Godesberg zur russischen Botschaft, wir organisierten ein Visum, meine Eltern buchten einen Aeroflot-Flug, und ich flog alleine nach Moskau. Ich hatte wildes Heimweh. Aber ich hatte niemals Angst. Ich lernte, ohne das Backup vertrauter Menschen zurechtzukommen und arrangierte mich mit fremden Gepflogenheiten. Es gelang mir, mich zu verständigen und hakelige Situationen diplomatisch zu meistern. Denn wir blieben nicht in Moskau: Wir fuhren mit dem Nachtzug nach St. Petersburg. Dort lernte ich eine befreundete Familie kennen. Deren Tochter, etwa im gleichen Alter wie ich, war glühende Anhängerin des Kommunismus und fand mich als Vertreterin des kapitalistischen Westens maximal doof. Ich fand sie auch doof, allerdings aus völlig unpolitischen Gründen. Wir mussten irgendwie zurechtkommen, ohne dass es zum Zerwürfnis kam und ohne dass ich meine Gastfamilie brüskierte. Ich lernte Moskau und St. Petersburg kennen – prächtige, geschichtsträchtige Städte. Ich erlebte Gastfreundschaft. Ich sah die Welt aus einer anderen Perspektive. Es waren spannende Wochen, und ich habe gelernt: Ich kann herausfordernde Situationen meistern.
Als erste in der Familie Abitur machen, studieren und promovieren. Während ich drinsteckte, fand ich es nicht so besonders, rückblickend, nach vielen Gesprächen mit Menschen aus Akademikerhaushalten, stelle ich fest, wie anstrengend meine Studium eigentlich war – und zwar nicht der Lernstoff, sondern das Zurechtkommen in dieser anderen Welt. Schon ab der weiterführenden Schule konnte mir niemand mehr mit dem Lernstoff helfen. Als ich dann ein Studium begann, gab keine Orientierungswoche. Ich baute mir meinen Stundenplan folglich frei Schnauze. Alles, wo „Einführung ..“ drauf stand, erschien mir sinnvoll, dazu setzte ich mich in Seminare, die mich interessierten und schrieb die Prüfungen. Dadurch absolvierte schon im ersten Semester einen Teil meiner Zwischenprüfung des vierten Semesters. Erst danach erfuhr ich, dass es Studien- und Prüfungsordnungen gibt. Wie viele Stipendienmöglichkeiten ich gehabt hätte, erfuhr ich erst nach dem Studium, als ich schon wissenschaftliche Mitarbeiterin war – schade, Marmelade. Stattdessen arbeitete ich während des Studiums viel. Teilweise hatte ich vier Jobs gleichzeitig: Mittwochs gab ich immer Englisch- und Latein-Nachhilfe, montags arbeitete ich als Tutorin für Erstsemester, am Wochenende schrieb ich für die Lokalzeitung in der Heimat, und in den Semesterferien baute ich Messestände auf oder arbeitete in einer Buchbinderei. Letztendlich habe ich gelernt, mir Dinge selbst zu erarbeiten. Außerdem bin ich durch meine Biografie in vielen (Berufs-)Gruppen anschlussfähig, weil ich die soziale Sprache spreche.
19 Jahre Beziehung mit einem Berufssoldaten, davon 16 Jahre Fernbeziehung und zwei Auslandseinsätze. Während des Studiums pendelte ich viel – nicht nur zur Wochenendarbeit in die Heimat, sondern auch zur Bundeswehrhochschule nach Neubiberg. Dort studierte mein Partner. 19 Jahre lebte ich mit ihm in der Welt der Bundeswehr, war die Frau an seiner Seite – bei Batallionsveranstaltungen, Gabelformalen, Kompanieübergaben und auf Auslandsreisen zu befreundeten Armeen. Mein Partner war zweimal in Afghanistan: beim ersten Mal sieben Monate, beim zweiten Mal vier Monate. Eine prägende Zeit für ihn, aber auch für mich. Ich lebte mit der permanenten Angst, dass er stirbt, schwer verletzt oder traumatisiert wird. Gleichzeitig war daheim viel zu tun. Das Wieder-Zusammenfinden nach solch einer Rückkehr ist auch eine schräge Erfahrung.
Gelesen | Sabin Tambrea: Vaterländer. Das Buch beginnt mit der Perspektive des jungen Sabin, wie er als Kind nach Deutschland kam, wie er sich einfand und seine Familie zwischen Marl und Târgu Mureș, Rumänien, lebte, wo sie die Sommerferien verbrachte. Es folgen die Perspektive seiner Großvaters, der während des Ceauceșcu-Regimes in Haft saß, und die seines Vaters Bela, dem Konzertmusiker, der auswanderte und schließlich seine Familie nachholte. Gut gefiel mir der Blick in die Familiengeschichte, die persönlichen Motive, die Erlebnisse. Weniger gut gefiel mir die Wikipedia-hafte Wiedergabe der politischen und geschichtlichen Rahmenhandlung.
Schweine | Schnee? Warum?!?!