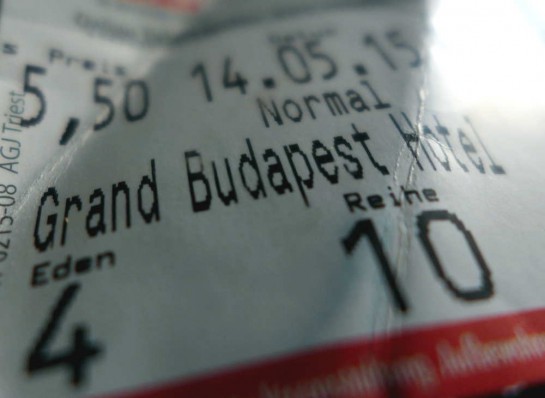Drei Tage Holland.
Die Niederländer mögen es mir nachsehen: Ich wohne kaum eineinhalb Fahrstunden von ihrem schönen Land entfernt, aber ich war erst zweimal dort. Zu meiner Verteidigung darf ich anführen, dass ich auch nur eineinhalb Fahrstunden von Bielefeld entfernt wohne und und sogar noch nie dort war. Oder sagen wir: Noch nie dort ausgestiegen bin.
Holland also. Vor allem: Den Haag. Das kennt man – irgendwie. Dort ist doch dieses Kriegsverbrechertribunal. Das war auch schon alles, was mir zu Den Haag einfiel. Ein guter Grund, um dorthin zu fahren.
Den Haag liegt am Strand, an der Nordsee, hat demzufolge Wasser, Sand und eine Promenade, auf der sogar ein Karussel steht.

Scheveningen, Promenade.
Das alles genügt, um den ersten halben Tag zu verweilen. Denn Meer und Strand ist etwas, dem ich lange, sehr lange zuschauen kann. Wasser, wie es anlandet, wieder wegfließt, wieder anlandet, wie es Steinchen und Muscheln rollen lässt, wieder fortzieht, rollen lässt, wie es Schiffe trägt, große Schiffe, die nach Rotterdam in den Hafen wollen, wie es überhaupt einfach da ist, wie es Möwen und Menschen beschäftigt.

Scheveningen, Strand.
Die Menschen, sie laufen den Strand auf und ab. So wie ich selbst. Ich schaue sie an, schaue ihnen zu, wie sie ihren bettelnden Hunden Bälle werfen, wie die Hunde den Strand entlang stürmen, wie sie hart in die Bremsen steigen, wie sie den Ball fangen, ihn zurücktragen und wieder bettelnd vor ihren Menschen stehen. Wie die Menschen den Ball werfen, diesmal ins Meer, wie die Hunde hineinstürmen, wie sie feststellen, dass das Wasser tief und nass und salzig ist, wie sie schnaufend wieder herausschwimmen und warten, bis das Meer ihnen den Ball vor die Füße trägt, wie sie den Ball aufnehmen und wieder zu ihren Menschen tragen, auf dass diese ihrem Betteln erneut nachgeben und werfen.
Währenddessen weht der Wind, zerzaust die Haare der Menschen und der Hunde. Die Haut prickelt, kleine Sandkörner pieksen, und alles ist perfekt.
Auf dem Weg nach Den Haag kommt man, wenn man möchte, durch die Provinz Utrecht, am Paleis Soestdijk in Baarn vorbei. Dort gibt es keinen Sand, keinen Strand, kein Meer. Dort gibt es Parks und Wälder, große Bäume, alte Bäume.

Baarn, nahe Paleis Soestdijk.
Ich besuche gerne Schlösser und Burgen. Ich mag es, mir vorzustellen, wie die Menschen dort leben und gelebt haben. Ich mag mir vorstellen, wie kleine Prinzen und Prinzessinnen in diesem Park gespielt haben. Wie sie dieses Dinosaurierskelett entdecken haben und hinaufklettern. Doch Vorsicht! Der Riese ist noch nicht ausgestorben. Er lebt noch, er atmet und Achtung! Er erhebt sich! In Deckung! Wir müssen ihn bekämpfen! Holt euch Waffen!

Soestdijk: Ein Dinosaurier im Park des Paleis.
Äste und Stöcke werden zu Speeren und Gewehren. Der Feind ist gefährlich, er kann Feuer spucken und hat giftige Stachel. Deshalb nähern sich die Jäger von hinten. Vorsichtig pirschen sie sich an und – waaaaah! Auf ihn! Erlegt ihn!
Oben an der Küste, in Den Haag gelange ich dann tatsächlich zum Internationalen Gerichtshof. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber er ist genau so, wie ich ihn mir nicht vorgestellt habe: alt, kirchlich, Big-Ben-haft.

Internationaler Gerichtshof
Mit großen Orten ist es ja so, dass sie in Wirklichkeit sehr klein sind. Dass man sie gar nicht als das erkennt, was sie sind: bedeutend und voller Geschichte. Wenn ich an all die Orte denke, an denen ich bereits gewesen bin, an denen Menschen starben und Schlachten geschlagen wurden, an denen Entscheidungen fielen und jemand Leben rettete – diese Orte alle sind Jahre später nichts weiter als Wiesen und Gebäude, als Straßen und Plätze wie andere Straßen und Plätze.

Nelson und ich.
Am letzten Tag aber traf ich, in der Nähe von Europol und der OPCW, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, einen großen Mann, dem ich seine Größe ansehen konnte.
The Hague. Mit dem Zug vom Ruhrgebiet aus über Duisburg und Utrecht. 3 Stunden Fahrzeit. Sparpreis in der 1. Klasse: 59€ pro Strecke. Novotel The Hague World Forum: 90€/Nacht. Speculaasmoppen: 3,75€. Sonne, Strand und Wind: unbezahlbar.