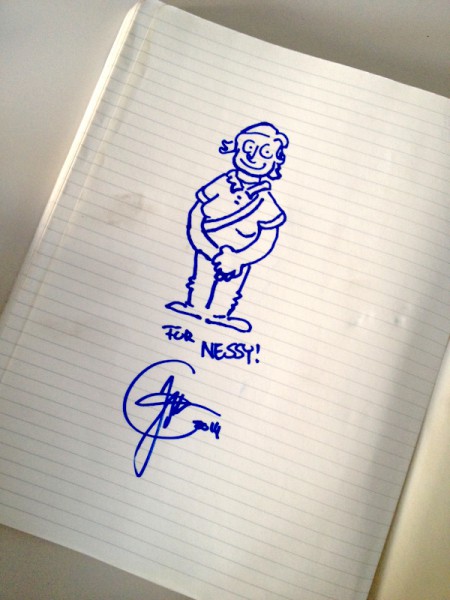Langmut
Nehmen wir meine Studienzeit.
Ich habe unter anderem Italienisch studiert und die italienische Sprache erst zu Beginn des Studiums erlernt. Es gab einen Intensivkurs, in den jeder ging, der es nötig hatte, und in dem die Grundfertigkeiten durchgeackert wurden. Wir wurden mit Unmengen von Vokabeln und Grammatik beschüttet. Parallel habe ich in den anderen Kursen die „Einführung in die Literaturwissenschaft“ und die „Einführung in die Sprachwissenschaft“ absolviert, dazu natürlich die Seminare der verbleibenden Fächer – und nebenbei in zwei Jobs gearbeitet. Ich war also nicht unbedingt unterbeschäftigt. Trotzdem ging das Sprachenlernen locker von der Hand: Nach einem Semester bin ich nach Italien in den Urlaub gefahren, kam dort gut zurecht, habe um Zimmerpreise gefeilscht, habe mir „Die Säulen der Erde“ gekauft, gelesen, und bis auf bautechnische Spezifika von Kathedralen auch verstanden.
Seit September lerne ich nun Russisch und es gestaltet sich deutlich mühseliger. Das liegt zum einen daran, dass ich keine Vorkenntnisse in slawischen Sprachen habe. Zum anderen aber auch daran, dass neben einem normalen Job, der Fahrt zur Arbeit, Tomatengießen, Sport und den Freunden, die ich auch treffen möchte, nicht viel Zeit übrig bleibt, um mich dem Russischen zu widmen. Bisweilen würde die Zeit, ihr reines Vorhandensein, sogar ausreichen – eine regelmäßige halbe Stunde genügt ja -, doch nach zehn Stunden im Büro, nach Telefonaten, Mails, Sitzungen, Plänen, Konzeptionen und Diskussionen bin ich oft viel zu müde zum Sprachenlernen, dann funktioniert nur noch Gartenarbeit; es geht einfach nichts rein in den Schädel.
Das ist frustrierend, vor allem weil ich ein höheres Tempo gewohnt bin. Eine Hilfe ist immerhin, dass mir meine russische Freundin mittlerweile in ihrer Muttersprache schreibt. Denn das, was in Lehrbüchern steht, geht irgendwie an meinem Vokabelbedarf vorbei: Dass ich mich und meine Firma demnächst bei einem Geschäftsessen vorstellen muss, wird nicht passieren. Ich antworte ihr in einem Russisch-Englisch-Kauderwelsch – mehr Englisch als Russisch, aber immerhin, mühsam ernährt sich бе́лка, Bjilka, das Eichhörnchen: Wir unterhalten uns immerhin über Dinge, über die man sich halt so unterhält. So taste ich mich Wort und Wort, Wendung für Wendung, voran.
Wenn ich es mir also bei Licht betrachte, ist diese Russischsache vor allem für eines gut: um meinen Langmut und mein Durchhaltevermögen zu trainieren.