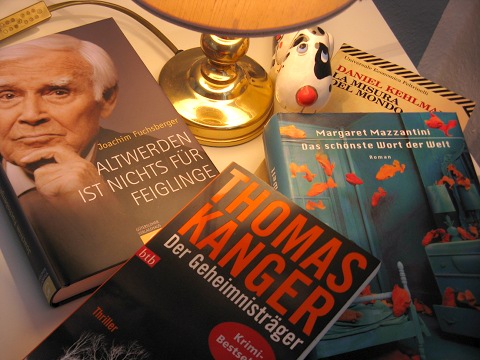In meiner Kindheit wurde ich zum Sparen erzogen.
Als Pimpf bekam ich eine Spardose. Dort warf ich Pfennige ein. Am Weltspartag trug ich sie in die Sparkasse, bekam ein Knax-Heft und einen Eintrag in mein Sparbuch. Diese Vorgehen war mühsam, aber so einträglich, dass ich das Prinzip auch im Erwachsenenalter beibehalte.
Statt Pfennige spare ich nun Zwei-Euro-Münzen. Kommt mir eine unter, bringe ich sie nicht wieder in den Umlauf, sondern lege sie in eine alte, hölzerne Zigarrenschachtel. So kommt über Monate ein erkleckliches Sümmchen zusammen. Ich genehmige mir davon Urlaube oder andere Sonderausgaben.
Geändert haben sich seit der Knax-Zeit nur die Kreditinstitute.
Als ich dort vor einigen Jahren erstmalig mit meinem Zigarrenkästchen auflief und sagte, ich wolle dieses gesparte Geld auf mein Sparkonto einzahlen, schaute mich das Schalterfräulein befremdet an. Das seien ja alles Münzen, sagte es, wie ich mir das vorstelle. Ich antwortete, dass ich es mir so vorstelle, dass sie das Geld in eine Zählmaschine werfe, es auf meinem Konto aufbuche und mir eine Quittung darüber aushändige. Eine Zählmaschine, sagte das Fräulein, gebe es in ihrem Hause nicht mehr, nicht für Privatkunden, die habe man abgeschafft, weil es inzwischen schließlich andere Möglichkeiten gebe, wenn man sich mal etwas Besonderes leisten wolle, ob sie mich darüber mal informieren solle. Nein, antwortete ich, das sei nicht vonnöten. Ich sagte, dass ich das Beiseitelegen von Geld für die bewährteste Methode hielte, Anschaffungen zu tätigen und zu Vermögen zu kommen.
Nach einigem Hin und Her zählte das Fräulein das Geld dann per Hand, gab mir aber einige Blätter mit, in die ich die Münzen in Zukunft einrollen solle, falls ich gedenke, weiterhin auf diese antiquierte Weise zu wirtschaften. Seitdem rolle ich die Euromünzen, bevor ich sie zur Bank bringe.
Doch jedesmal, wenn ich umziehe und infolgedessen eine neue Filiale aufsuche, ist das Schalterfräulein gleichermaßen verwirrt und beginnt augenblicklich, mich über Kredite und Anlageformen zu unterrichten. Gestern sagte es – und sah mich dabei an wie Mutter Teresa einen Leprakranken -, auch für den kleinen Geldbeutel gebe es Möglichkeiten. In diesen Zeiten müsse man sich wirklich nichts mehr vom Munde absparen, was denn genau meine Wünsche seien, sie helfe gerne, das sei das Selbstverständnis ihres Hauses.
Mein Wunsch, sagte ich, sei, dass sie mich nicht Kreditangeboten belästige, nicht mündlich und nicht schriftlich, auch wolle ich keine Beteiligungen erwerben oder angerufen werden, was mit den Kröten auf meinem Sparbuch geschehen solle. Ich wolle gerne einfach nur sparen – und bitte eine neue Spardose haben, denn meine Kiste sei in die Jahren gekommen und recht ramponiert.
Spardosen, sagte das Fräulein, gebe sie schon seit Jahren nicht mehr aus.